Alltagsobjekte neu erleben
„(…) Und vergesst nicht, dass die Erde es genießt, eure bloßen Füße zu spüren, und die Winde sich danach sehnen, mit eurem Haar zu spielen.“
Khalil Gibran [1]
In diesem Kapitel Alltagsobjekte möchte ich die Lernenden dazu einladen, ihre Beziehung zu Objekten einmal zu hinterfragen oder zu durchleuchten. Und zu ermuntern Alltagsobjekte neu zu sehen. „Wenn wir vom Alltag sprechen, so bezeichnen wir damit in der Regel jene Bereiche unseres täglichen Lebens, in denen selten Spektakuläres geschieht. Dazu zählen unsere Angewohnheiten und die Dinge, die uns zwar ständig umgeben, denen wir aber dennoch selten bewusst Aufmerksamkeit schenken. Alltag ist für uns all das, was sich regelmäßig wiederholt und das wir deshalb auch nicht mehr hinterfragen. Er ist das Selbstverständliche schlechthin, das Vertraute, das man nicht nur versteht (epistemische Vertrautheit), sondern auf das man sich versteht (praktische Vertrautheit) im Sinne von Alltagskompetenz.“ [2]
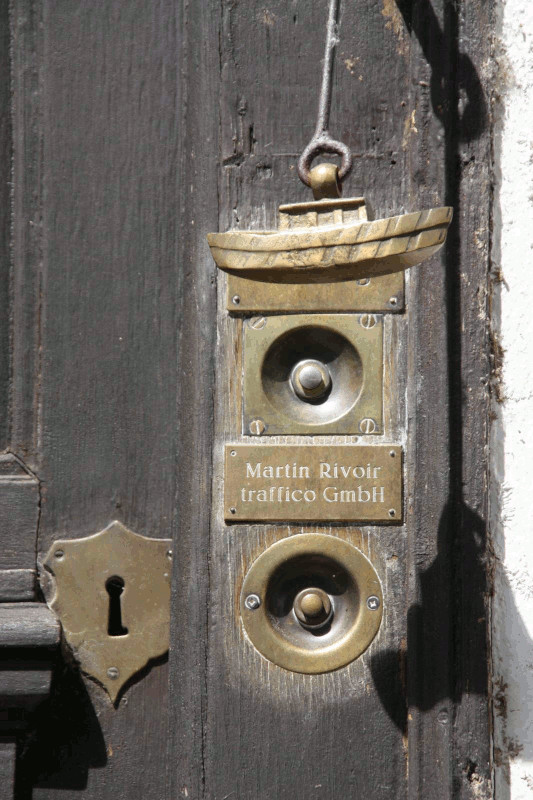


Alltagsobjekte neu erleben
Viele Dinge bestehen aus wertvollen Ressourcen. Menschen haben ihre Kraft und Kreativität in den Konzeptions-und Herstellungsprozess investiert. Deshalb sollten wir mehrmals überlegen, ob wir sie überhaupt kaufen müssen, sie wegwerfen möchten oder ihnen irgendwie ein zweites Leben schenken könnten. Damit könnten wir zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Konsumverhalten beitragen. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass wir an gewissen Objekten hängen, weil sie etwas über unsere Geschichte sagen, unser emotionales Transferobjekt sind oder waren. Sie werden gehütet wie ein Schatz auch wenn sich ihr täglicher Gebrauch geändert hat. Objekte bevölkern unseren persönlichen Raum, können Nutzgegenstände, reine Dekoration, Mittel um uns künstlerisch auszudrücken, zu kleiden, zu sammeln… etc. sein.
Der Mensch hat sich seit seinem Bestehen mit Objekten umgeben. Heute nehmen wir sie gar nicht mehr so richtig wahr, weil sie zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind. Meistens wissen wir gar nicht, woher sie kommen, wer sie erfunden hat.
(…) Für euch hält die Erde ihre Früchte bereit, und
Ihr braucht euch nicht zu fragen, ob, sondern wie
ihr eure Hände füllen könnt.
Im Tauschen der Geschenke der Erde werdet
ihr Überfluss und Befriedigung finden.
Wenn jedoch dieser Tausch nicht in Liebe und
wohlgesinnter Gerechtigkeit stattfindet, dann
führt er bei einigen lediglich zur Gier und bei
anderen zu Hunger.“
Kahlil Gibran[3]
Alltagsobjekte neu erleben
Das Kollektiv französischer Produktdesigner Collections Typologie interessiert sich für sogenannte „namenlose Gegenstände“ wie etwa die Weinflasche. Sie gehört zu jenen Alltagsobjekten, die wir schon fast nicht mehr bewusst wahrnehmen. Der Korken ist ein weiteres Beispiel für einen Gegenstand, der unverändert geblieben ist, obwohl es inzwischen neue Herstellungsmöglichkeiten gibt. In der Regel sind die Autoren oder Autorinnen dieser Objekte der alltäglichen Dingwelt unbekannt. Sie werden zu der Kategorie „No Name Design“ gezählt. Nach ausführlichen Recherchearbeiten werden diese Objekte dann künstlerisch gestaltet in Ausstellungen vorgestellt.
Ich möchte Ihnen vorschlagen sich mit Ihren Lernenden auch auf die Spuren von Objekten zu machen. In den hier vorgeschlagenen Aktivitäten wird es um persönliche Objekte gehen, die jede Person für sich selbst auswählen kann aber auch um Vorschläge von Dingen mit fast schon universellem Wert wie zum Beispiel die Küchenschürze (die heute leider immer mehr aus den Küchen verschwindet).
Außerdem möchte ich die Aufmerksamkeit auf typisch deutsche Objekte lenken. Da wir im Sprachunterricht immer auch auf kulturelle Besonderheiten achten sollten, scheint mir das hier ein geeigneter Ort zu sein. Bestimmte Objekte drücken auch immer etwas über die Kultur und Geschichte des fremden Landes aus. Das wird zum Beispiel auch auf sehr originelle Art und Weise in der Arte Sendung Karambolage gezeigt. Dort werden sowohl auf humorvolle als auch informative Art und Weise unter anderem anhand von Objekten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern Deutschland und Frankreich herausgearbeitet.

„Das Fremde des anderen ist das eigene Fremde, das sich im Blick des anderen spiegelt.“
Max Frisch
Interkulturelles Lernen
Landeskundliche Inhalte gehören zu einem festen Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts. Spracherwerb und Vermittlung landeskundlicher Inhalte werden in den vorgeschlagenen Übungen nicht getrennt. Sprache an sich ist schon Bestandteil oder Träger der Kultur. Nach den Worten Richard Johnsons muss Landeskunde „mit erzieherischer Innovation verbunden sein. Dabei ist sie keineswegs optionaler, sondern ein integrierter Bestandteil des Unterrichts.“ [4] Bei der Arbeit mit kreativen Mitteln handelt es sich gewissermaßen um „erlebte Landeskunde », denn die Auseinandersetzung mit dem Fremden beinhaltet den Einbezug des persönlichen Vorwissens, sowie der eigenen Erfahrungen der Lernenden. Das Verständnis für die andere Kultur kann dadurch vertieft und neue Perspektiven eröffnet werden. Lernende werden sich immer die fremde Kultur über Vergleiche mit dem eigenen kulturellen Hintergrund erschließen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten. Je facettenreicher die fremde Kultur wahrgenommen wird, desto größer ist die Chance dem Klischee-und Schubladendenken, mit dem man versucht eine komplexe Realität zu vereinfachen, vorzugreifen. „Interkulturelles Lernen ist nicht eine beliebige, sondern eine selbstverständliche Reaktion auf eine offenkundige gesellschaftliche Diskrepanz. Der nahe Fremde ist zum Normalfall fast aller modernen Gesellschaften geworden – wird aber immer noch weitgehend als Besonderheit oder Anomalie wahrgenommen und behandelt.“ [5]
Kreatives Arbeiten ermöglicht ferner, potentielle Lern-und Erfahrungsräume zu schaffen, in denen die Lernenden ihre Aktivität spontan entwickeln können und sie als aktiver Teil in den Lernprozess mit einbezogen werden. Das Ziel ist es, fremde Lebenswelten und Verhaltensweisen besser zu verstehen und „Brücken der Verständigung“ zu bauen. Das beinhaltet gleichzeitig auch die Beschäftigung mit der eigenen Kultur und Gesellschaft. Interkulturelles Lernen geht natürlich weit über die Beschäftigung mit emblematischen Objekten der Zielkultur hinaus. Es erlaubt aber auf spielerische Art und Weise, Besonderheiten des Landes kreativ herauszuarbeiten und Wahrnehmungs-und Empathiefähigkeiten zu entwickeln. Dabei sollte das entsprechende Objekt immer auch mit seiner oder einer Geschichte eingeführt werden, um den Horizont und das Verständnis der Lernenden von Anfang an zu erweitern.
[1] Gibran Khalil, Der Prophet, Diogenes, Zürich, 2005, Seite 40
[2] Quelle: Dirschler, Margit, Das Alltägliche ist plötzlich wieder Abenteuer geworden, Seite 2, unter: Hier
(abgerufen am 3.5.2024)
[3] Gibran Khalil, Der Prophet, op.cit,, Seite 42
[4] Zitiert von Wicke, Rainer-E., Grenzüberschreitungen, Iudicium, München, 2000, Seite 17
[5] Zitiert von Wicke, Rainer-E., Grenzüberschreitungen, op.cit. Seite 19